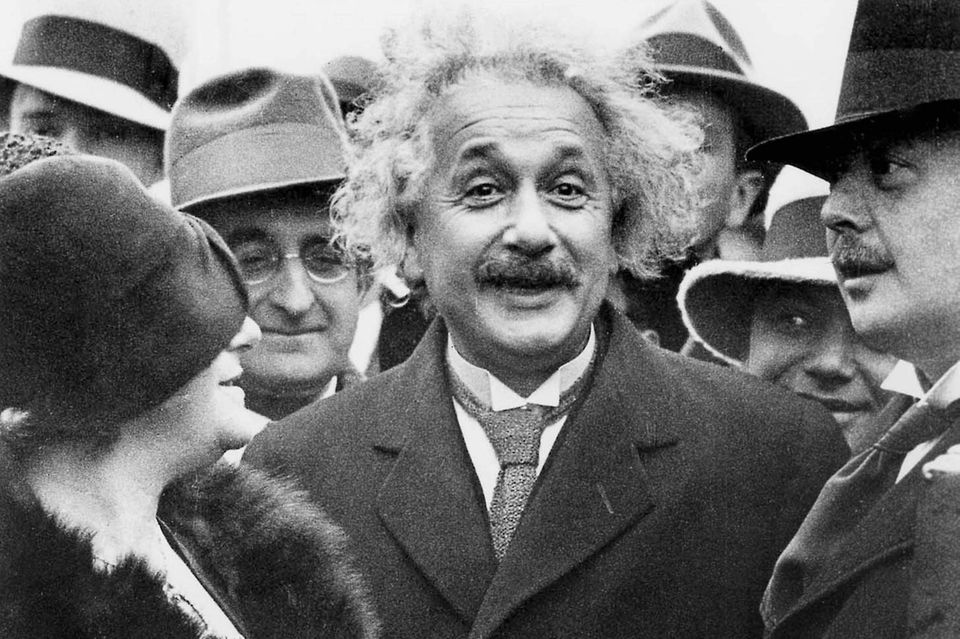Inhaltsverzeichnis
Nach drei Tagen im Gebirge kommt endlich der Regen. Wie eine kalte Faust schlägt er uns ohne Vorwarnung ins Gesicht, während wir über die steinige Ebene zurück zu den Pferden hasten. Schwarze Wolken türmen sich auf dunklen Gipfeln, Blitze zucken durch einen aufgewühlten Himmel. Im Windschatten einer grauen Hütte hat Mafa Zufl ucht gefunden, kaum zu erkennen hinter der Wand aus eisigem Wasser. Er winkt uns mit ausgestrecktem Arm in seine Richtung und ruft gegen den grollenden Donner an.
Als wir hektisch die schweren Packtaschen von den Pferden wuchten, verwandeln sich die dicken Regentropfen in Hagel, an unseren durchnässten Jacken zerrt ein schneidender Wind. Dann sind wir im Innern der Hütte, deren Wände nach erkaltetem Rauch riechen und wo es warm und trocken ist. Mafa und Phakane, unsere einheimischen Führer, lassen sich auf Matten nieder, wickeln die bunten Decken fester um den Körper.
Im trägen, melodischen Singsang ihrer fremden Sprache nehmen sie die Unterhaltung wieder auf, die der Sturm so unerwartet unterbrochen hat. Wenige Minuten später ist das Unwetter weitergezogen. Als ich im Abendlicht vor die Hütte trete, dampft dichter Nebel von der Schlucht herauf, und ein zarter Regenbogen spannt sich über weit entfernte Berge, die goldgrün in der Sonne glänzen. "Es wird heute noch viel Regen geben", sagt Georgina, die herangetreten ist mit Decken und Kerzen für die Nacht. "Hörst du, wie der Donner näher kommt? Ihr habt Glück, dass euch das Gewitter hier überrascht hat." Georgina ist die Ehefrau des Häuptlings im Dorf, in seinen Gästehütten kommen wir unter.
Hoch über dem Ketane-Wasserfall
Ha Hlalele liegt hoch über dem Ketane-Wasserfall, eine verstreute Ansammlung steinerner Rundhäuser. Keine Straße führt hierher, nur eine Handvoll ausgetrampelte Pferdepfade an steilen Hängen entlang, auf denen auch wir hierher geritten sind. "Wir haben so lange auf Regen gewartet", sagt Georgina. "Ich bin froh, dass er endlich da ist. Aber die Blitze machen mir Angst." In ihren Händen hält sie einen kurzen Stock mit einer Astgabel an der Spitze, schwenkt ihn in kreisenden Bewegungen hoch über dem Kopf, während sie langsam eine Hütte nach der anderen abschreitet. Der thakhisa, geformt wie eine Wünschelrute, ist eine Art magischer Blitzableiter, das Ritual wird ihr Heim vor dem nahen Sturm beschützen. Die ganze Nacht über, während Wind und Regen am Strohdach unserer Behausung rütteln, werden wir sicher und geborgen schlafen.
Am nächsten Morgen weckt mich das verzweifelte Schluchzen einer Frau, ein langgezogenes, gespenstisches Wehklagen, das aus einer der dunklen Hütten dringt. "Eine Mutter trauert um ihren Sohn, einen Hirtenjungen aus den Bergen", sagt Georgina, die aus einer grünen Plastikschüssel den Hühnern Korn zustreut. In der Nacht habe er in einem Nachbardorf mit Freunden Pferde stehlen wollen. Die Bewohner dort fassten und erschlugen ihn. "Seine Mutter ist zum Häuptling gekommen, damit er die Mörder der Polizei ausliefert."
Unterwegs mit Schwarzer Berg
Beim Beladen der Packpferde sagt Phakane, unser sanftmütiger Führer, der niemals die Stimme hebt und stets gelassen bleibt: "Die Mutter tut mir sehr leid. Aber der Junge war ein Pferdedieb, er wusste, worauf er sich einlässt." Ernste Augen sehen mich über den Sattel hinweg an. Ein schmales, dunkles, undurchdringliches Gesicht, das nichts erzählt. Malealea Lodge, drei Tage zuvor. "Ich heiße Phakane und werde euch begleiten", sagt der Mann, der mir die Zügel reicht. "Das ist dein Pferd ‚Thabantso‘, der Name bedeutet ‚Schwarzer Berg‘." Wir sind am vorigen Abend in Malealea eingetroffen, nach 70 Kilometern Autofahrt von Maseru, der Hauptstadt im Tiefl and, hinauf über den windumtosten "Paradise Pass" bis in diese Lodge zu Füßen des Thaba-Putsoa-Gebirges. Von hier aus wollen wir vier Tage lang zu Fuß und zu Pferd durch die Wildnis Lesothos wandern, eines Staates, nicht größer als Belgien, bewohnt von Bergbauern und Hirten, auf allen Seiten umschlossen von Südafrika. "Königreich im Himmel" wird Lesotho auch genannt oder "Dach Afrikas", weil noch sein tiefster Punkt 1400 Meter hoch über dem Meeresspiegel liegt. Malealea ist so etwas wie die Eingangspforte zu den vergessenen Winkeln dieses Königreichs, ein letzter Tupfen Zivilisation vor dem Abenteuer. Backpacker und Einheimische versammeln sich vor der Lodge, als wir die Pferde beladen. Von der Terrasse spähen Gäste über ihre Frühstücksteller mit Eiern und Speck hinweg in unsere Richtung. Ein schmutziger Hund schnappt nach einem Pferd, Kies knirscht unter Hufen, im Buschwerk gurren Tauben. Mit in die Hüften gestemmten Armen steht
Jochen Beckert, ein deutschstämmiger Farmerssohn aus Namibia, der von Kapstadt aus Touren durch Lesotho organisiert, zwischen Bergen aus Satteltaschen und Zaumzeug und überprüft die Ausrüstung. Er wird unsere Gruppe anführen. "Die Pferde sehen mager aus", sagt er mit dunkler Reibeisenstimme. "Wir hatten lange keinen Regen", antwortet Phakane. "Das Gras ist schlecht."
Ich bin zuvor noch niemals auf einem Pferd gesessen. "'Schwarzer Berg" kommt mir in diesem Augenblick wahrhaftig wie ein Berg vor, seine dunklen Augen beobachten mich beim Aufsteigen. Ohne ein Kommando abzuwarten, reiht sich der Wallach gleichmütig in die Gruppe ein. Mit gesenktem Kopf folgt er Jochen und dem Packpferd, während ich die Zügel fester nehme und vor unseren Zuschauern Würde zu bewahren suche. Der Weg führt zunächst über flaches Land. Jochen reitet neben mir und erklärt, wie man sich im Sattel hält und mit den Zügeln dem Pferd die Richtung vorgibt. Alle Ratschläge sind vergessen, als sich plötzlich ein jäher Abgrund vor uns auftut. In steilen Kurven führt ein kaum sichtbarer Pfad nach unten. Mit einem hässlichen, schabenden Geräusch schlittert mein Pferd über nackten Fels, fast stolpert es, findet schnaubend wieder festen Halt, setzt zögernd seinen Weg in die Tiefe fort. Ich lehne mich mit durchgedrückten Knien weit nach hinten und überlasse es dem Tier, sich den besten Weg über das nachgiebige Geröll zu ertasten. Unten am Flussbett ist mein Hemd schweißnass. Den ganzen Tag reiten wir in gemächlichem Tempo und unter strahlendem Sonnenschein durchs Land. Der Blick über den schlanken, muskulösen Hals von "Schwarzer Berg" wird mir zur vertrauten Ansicht. Jochen führt die Gruppe an, auf dem Kopf einen breitkrempigen Hut, in der Hand eine Reitgerte aus einem unterwegs abgerissenen Zweig, mit der er sein Pferd vorantreibt.
Dahinter Phakane, gekleidet in die traditionelle Tracht der Basotho, wie die Einwohner Lesothos heißen: die wollene, bunte Hirtendecke um die Schultern geschlungen, das Gesicht beschattet von dem kegelförmigen Strohhut mit einem gefl ochtenen, hohen Knoten an der Spitze. An Phakanes Seite eines der Packpferde, beladen mit zwei blauen Taschen und einem gelben Kanister für Trinkwasser. Hinter mir reitet Mafa, unser zweiter Basotho-Begleiter, der ein weiteres Packpferd führt.
Unser Weg führt durch sonnige Täler, in denen die Luft nach wildem Salbei duftet, und im Wind wogt hüfthohes Gras wie das Wellenspiel eines goldgelben Meeres. Dann geht es hinauf auf karge, baumlose Hochebenen, sanft betupft von den braunen Erdhügeln der Ohrenratten, die Tunnel in den ausgedörrten Boden gegraben haben. Wir passieren Mais- und Hirsefelder, die sich terrassenförmig als gelbe Bänder an die Hänge schmiegen, und tauchen ein in die kalten Schatten hoher Basaltgipfel, an deren Flanken sich schmale Pfade entlangwinden, mit einem hunderte Meter tiefen Abgrund zu unserer Rechten. Die Bergwelt Lesothos ist ein Land ohne Zäune, ohne Grenzen, Markierungen und Straßen. Kein Farmer wird uns auf unserer viertägigen Reise von seinen Feldern jagen, kein Auto unsere Wege kreuzen, und wir werden keinem anderen Touristen begegnen. Im warmen Licht der Abendsonne schlagen wir auf einem Hochplateau zwischen grasenden Schafen unser Lager auf. Das nächste Dorf ist weit entfernt, eine Gruppe Hirtenjungen in dunklen Decken, die bis zum Wintereinbruch mit ihren Herden in den Bergen leben, sehen uns beim Aufbau der Zelte zu, schweigsam und scheu in einer Reihe Abstand haltend. Weil es in der Nähe keine saubere Quelle gibt, haben Mafa und Phakane ein Loch in den Boden gegraben und schöpfen Grundwasser, das wir zum Kochen verwenden und trinken können. Als die Sonne versinkt, wird es schlagartig kalt, und dann bricht die schwarze afrikanische Nacht herein, mit einem fremden, tiefklaren Sternenhimmel aus Milchstraßen, Orionnebel und dem Kreuz des Südens.
Wie Europa vor hunderten von Jahren
"Ich kann mich noch gut an mein erstes Trekking hier erinnern", sagt Jochen nach dem Abendessen, im Schein der Petroleumlampe vor den Zelten. 1999 hatte er sich in den Kopf gesetzt, das Land von West nach Ost zu durchqueren, 300 Kilometer weit durch unbekanntes Gebirge und zu Fuß. In Malealea wollte er starten, fand aber keinen Einheimischen, der bereit gewesen wäre, ihn zu führen. Man hielt ihn für verrückt, niemand war jemals so weit durch die Wildnis marschiert. "Das ist wie in Europa vor ein paar hundert Jahren", sagt Jochen. "Die Leute kennen ihr eigenes Dorf und ein paar Nachbardörfer, das war’s." Als es schon dunkel wurde, trat ein alter Mann auf ihn zu und erklärte sich zögerlich einverstanden, ihn am nächsten Morgen zu begleiten. Sie orientierten sich am Stand der Sonne und den Höhenzügen auf der Karte, sie fragten Hirten nach dem Weg und rasteten in kleinen Dörfern. Jochen ging zu Fuß, der Basotho ritt, das Packpferd führend, hinter ihm. Die Hufe der Tiere waren so schlecht beschlagen, dass die beiden die Eisen immer wieder wechseln mussten; als ihnen die Nägel ausgingen, behalfen sie sich mit Draht. In T-Shirt, kurzen Hosen und Sandalen war Jochen in Malealea losgelaufen, und genauso angezogen kam er 13 Tage später an der Grenze im Osten an - schmutzstarrend, abgemagert, unrasiert.
Als ich in mein Zelt krieche, ruft er mir hinterher: "Keine Angst, in Lesotho gibt es keine wilden Tiere mehr, höchstens noch ein paar Hyänen." Den wohl letzten Löwen im Land schossen Jäger um 1870, auch Zebras, Flusspferde und Leoparden gibt es hier seit langem nicht mehr. Das gleichmäßige Schaukeln auf dem Pferderücken hat, als ich die Augen schließe, meinen Körper noch nicht verlassen. Sacht wiegt mich der Rhythmus in einen tiefen Schlaf.
Am nächsten Tag reiten wir durch hohes Buschwerk mit leuchtend roten Beeren, das uns die Arme blutig reißt, und begegnen einer Gruppe Kinder auf dem Weg zu ihrem Dorf. "Lekhooa, lekhooa", schreien sie aufgekratzt, "weißer Mann, weißer Mann!" Sie betteln um Bonbons, pom-pom - ein Geschenk, dessen sich schon die ersten französischen Missionare im 19. Jahrhundert bedienten, um die Basotho in die Kirchen zu locken. Auf einem Feld steht ein Esel einsam in der Mittagssonne, dann überholen wir zwei Frauen, die riesige Bündel Feuerholz auf den Köpfen tragen und ein paar träge, flirtende Worte mit unseren Führern wechseln. "Siehst du den weißen Sack, der dort drüben an dem Pfahl hängt?", fragt Jochen und deutet auf eine Hütte im nächsten Dorf. "Das bedeutet, dass es frisch gebrautes Bier gibt." Hinter mir singt Phakane eine langsame, sehnsuchtsvolle Melodie, abwechselnd in hoher und tiefer Lage, zwei Stimmen, die einander zu antworten scheinen. "Was ist das für ein Lied?", frage ich und drehe mich im Sattel zu ihm um. "Ein Liebeslied", sagt er mit einem Lächeln.
Zwischenstopp in "Berg im Frost"
Thaba Sekoka, "Berg im Frost" heißt das Dorf, in dessen Nähe wir unser Nachtlager aufschlagen, auf 2800 Meter Höhe. Aus der Öffnung einer Hütte dringt dichter Rauch, im Inneren sitzen Frauen und Kinder in beißender Luft dichtgedrängt um eine Feuerstelle, auf der ein großer Kochtopf steht. Jede Familie besitzt mehrere dieser steinernen Rundhäuser, rondavels genannt, die als Kochstätte, Schlafplatz und Lagerraum dienen. An einer Leine baumelt bunte Wäsche, auf den Felsen trocknen Schaffelle in der Sonne, braun gescheckte Schweine wühlen sich grunzend durch den staubigen Boden. Vor der Hütte steht der fast 70-jährige Bauer Michael Lebona - weißer Bart in einem von tiefen Falten durchzogenen Gesicht, ein strahlendes Lächeln, das zur Hälfte aus Zahnlücken besteht - und erzählt mir vom harten Leben in den Bergen. Im vergangenen Winter sind ihm sechs seiner 14 Schafe gestorben; erfroren, weil sie schon geschoren waren, als unerwartet spät noch einmal Schnee fiel. In diesem Jahr ist die Regenzeit ausgeblieben. "Die Tiere haben Durst, und der Mais vertrocknet auf den Feldern", sagt er düster. Auch das Dorf sei früher größer gewesen, jetzt verlassen viele Junge die Gegend, um in den Städten und Diamantminen Südafrikas nach Arbeit zu suchen.
Eine Gruppe betagter Männer hat sich neugierig um uns versammelt. Zum Abschied wollen sie mir einen alten Basotho-Tanz zeigen, den ndlamo. Singend und klatschend, in immer wilderen, ekstatischen Bewegungen schleudern sie Arme und Beine hoch in die Luft, bis sie schließlich in einem erschöpften Lachanfall wie Puppen übereinanderfallen. "Eigentlich sind wir ja zu alt für diesen Tanz", sagt Michael Lebona mit keuchendem Atem, während er sich die Tränen aus dem Gesicht wischt. "Aber die jungen Männer sind noch auf den Feldern beim Vieh." Einer dieser Jungen begegnet mir auf dem Weg zurück ins Lager, vielleicht 15 Jahre alt, mit stolzem, kühlem Blick. Er trägt neue Decken in leuchtenden Farben, an denen silberne Glöckchen klingeln, und mehrere Ketten um den Hals - Geschenke, die ihm seine Eltern zur lebollang, zur Beschneidung, gemacht haben. Zum Auftakt dieses Rituals ziehen die Knaben in verlassene Hütten hoch oben in den Bergen, wo weise Alte sie die Regeln der Männlichkeit und geheime Lieder mit nie gehörten Worten lehren, die nur wahre Männer kennen dürfen. Nach der Initiation bleiben die Jungen noch einen Monat lang einsam im Gebirge fernab der Familien, bis ihnen zu Ehren ein großes Fest im Dorf gefeiert wird. Der nächste Morgen ist voller Wolken, die dunkle Flecken auf die Berge werfen, schwarze Kontinente auf einer Landkarte aus hunderten von Grün- und Brauntönen. Unsere Basotho-Führer folgen mit den Pferden, während wir durch Flusstäler wandern, in denen Weidenbäume wachsen und Schmetterlinge über Sonnenblumenfelder tanzen. Immerzu geht es bergauf oder bergab, die dünne Luft macht uns schnell atemlos, und die Wege, ausgetreten von unzähligen Pferdehufen, sind so schmal, dass keine zwei Füße nebeneinanderpassen.
Am vierten Tag führt unsere Route tiefer und tiefer, bis wir eine Ebene erreichen, wo sich die Gebirgspfade - wie Bäche, die zu einem Fluss werden, - in einer breiten, staubigen Straße vereinen. Sie bringt uns nach Semonkong, unserem Ziel. Die kleine Siedlung hat das Flair einer Wildweststadt. Vor einer Reihe schmutziger Wellblechhütten werden Decken, Mützen und rote Würste verkauft. Reiter mit wettergegerbtem Gesicht laden große Säcke Pferdefutter auf ihre Esel. In einer Baracke ist ein provisorischer Supermarkt untergebracht, hinter dessen Registrierkasse der chinesische Besitzer hungrig Reis aus einer Schale löffelt.
Endziel Drakensberge
Im Schatten der Geschäfte sitzen Ladenjungen auf unförmigen, afrikanischen Pop herausschreienden Lautsprecherboxen, und in einem offenen Lagerhaus zimmert ein Schreiner eifrig Särge. Erschöpft, unrasiert und ungewaschen reiten wir in die Stadt ein, in Richtung Lodge, einer kühlen Dusche, Steaks und dem starken, einheimischen Maluti-Bier entgegen. Drakensberge - so heißt im Osten der natürliche Grenzwall zu Südafrika, er ist das Endziel unserer Reise. Per Auto fahren wir zunächst nach Maseru, dann durch das Tiefl and, vorbei an kleinen Ortschaften, Ackerland und Straßenständen. Die Zivilisation meldet sich mit Macht zurück, Berge von Müll liegen am Wegesrand: leere Konservendosen, rostige Kanister und scharenweise Plastiktüten, die im Wind wie blaue Krähen auf den Feldern flattern.
Hinter der Stadt Butha-Buthe steigt die Straße wieder an, schlängelt sich durch zerklüftete Sandsteinformationen, die aus einem John-Ford-Western stammen könnten. Immer höher schraubt sich die von Schlaglöchern zernarbte Piste, die am Rand gesäumt ist von beunruhigenden Autowracks - bis in die Wolken. Hinter dichten Nebelschwaden zeichnen sich die Umrisse des "Sani Top Chalets" ab, daneben die Pfosten einer einsamen Grenzstation. Den Weg hinab nach Südafrika haben die Wolken längst verschluckt. Wir betreten the highest pub in Africa, wie ein Schild über dem Tresen stolz verkündet, auf 2874 Meter Höhe. Es ist eine Atmosphäre wie in einer Tiroler Berghütte: In der Ecke prasselt ein Feuer im Kamin, aus der Küche dringt der Duft von heißer Suppe, an der holzverkleideten Bar sitzen zwei Gäste beim Kartenspiel. Etwas abseits im Gang steht ein gutes Dutzend Paar Skier aufgereiht, mit den dazugehörigen Stiefeln in einem Bord. "Ja, es kann eine Menge Schnee hier oben fallen", sagt Jonathan Aldous, der Besitzer der Lodge, als er meinen erstaunten Blick bemerkt. "Im Winter ist der Pass oft eingeschneit, letztes Jahr mussten meine Gäste sogar mit Helikoptern evakuiert werden." Auch das ist Lesotho, das Königreich im Himmel: Ski fahren in Afrika.